Gebäudeversicherung: Kosten pro Quadratmeter
Wie viel kostet die Wohngebäudeversicherung pro m²? Wir zeigen Richtwerte, Einflussfaktoren und Rechenbeispiele

Die Gebäudeversicherung zählt zu den wichtigsten Policen für Hausbesitzer – denn sie schützt Ihre Immobilie vor finanziellen Schäden durch Feuer, Sturm, Leitungswasser und viele weitere Risiken. Doch was kostet dieser Schutz eigentlich pro Quadratmeter? Und wie berechnet sich die Prämie konkret für Ihre Wohnfläche, Region und Bauweise?
In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie Versicherer die Kosten pro Quadratmeter ermitteln, welche Faktoren Ihren Beitrag beeinflussen – und wie Sie durch gezielte Entscheidungen sparen können, ohne auf wichtigen Schutz zu verzichten. Ob Altbau, Neubau, vermietetes Haus oder denkmalgeschütztes Objekt: Wir zeigen Ihnen transparent, worauf es ankommt, wie viel Sie realistisch kalkulieren sollten – und wo sich der Vergleich besonders lohnt.
Das Wichtigste im Überblick
- Die jährlichen Kosten einer Gebäudeversicherung pro qm liegen durchschnittlich zwischen 1 € und 10 € – je nach Lage, Zustand und Deckungsumfang.
- Entscheidende Einflussfaktoren sind: Wohnfläche, Baujahr, Gebäudestandard, Region (z. B. Starkregen- oder Sturmrisiko) sowie gewählte Zusatzbausteine.
- Besonders hohe Prämien drohen in Elementarrisikogebieten oder bei Gebäuden mit Vorschäden und Sanierungsbedarf.
- Eigentümer können die Kosten auf Mieter umlegen – jedoch nur fair, transparent und im Rahmen der Betriebskostenverordnung.
- Ein Wechsel oder Vergleich der Tarife kann Einsparungen von mehreren Hundert Euro jährlich bringen – ohne Leistungseinbußen.
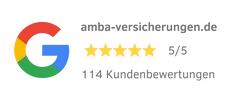
114 Bewertungen | 5,0 Sterne

328 Bewertungen | 4,9 Sterne

334 Bewertungen | 5,0 Sterne
Absicherung, auf die Sie sich verlassen können – auch im Ernstfall
Warum eine Wohngebäudeversicherung für Eigentümer unverzichtbar ist
Ein Haus ist nicht nur ein Ort zum Leben, sondern in den meisten Fällen die größte finanzielle Investition eines Menschen. Feuer, Sturm, Leitungswasserschäden oder gar Naturkatastrophen können diese Investition innerhalb weniger Minuten gefährden – mit Schäden, die schnell in die Hunderttausende gehen. Ohne eine Wohngebäudeversicherung tragen Sie dieses Risiko allein.
Die Versicherung übernimmt in solchen Fällen nicht nur die Reparaturkosten, sondern sichert im Ernstfall sogar den vollständigen Wiederaufbau Ihrer Immobilie. Auch Nebengebäude, fest verbaute Installationen und bestimmte Grundstücksbestandteile können mitversichert werden. Für viele Eigentümer stellt diese Absicherung die Grundlage ihrer finanziellen Existenzsicherung dar – insbesondere, wenn das Objekt vermietet ist oder als Altersvorsorge dient.
Darüber hinaus schreiben Banken bei der Immobilienfinanzierung den Nachweis einer Wohngebäudeversicherung verpflichtend vor. Und auch wenn sie gesetzlich nicht zwingend vorgeschrieben ist: Wer auf diese Absicherung verzichtet, riskiert im Schadensfall nicht nur sein Haus – sondern auch seine wirtschaftliche Zukunft.
Warum auch Eigenheimbesitzer nicht auf Versicherungsschutz verzichten sollten
Wer in der eigenen Immobilie lebt, ist für die Instandhaltung und Absicherung selbst verantwortlich. Eine Wohngebäudeversicherung schützt nicht nur vor finanziellen Belastungen, sondern sichert auch das Zuhause und die Lebensqualität.
Reparaturkosten bei Brand oder Wasserrohrbruch werden übernommen
Auch teure Schäden an Dach, Fassade oder Heizanlagen sind abgedeckt
Schutz vor Naturgefahren wie Sturm oder Hagel – insbesondere bei zunehmenden Extremwetterlagen
Bei unbewohnbarem Haus: Übernahme von Hotelkosten oder Mietausfall möglich
Warum Vermieter die Wohngebäudeversicherung niemals vernachlässigen sollten
Als Vermieter tragen Sie die Verantwortung für die Bausubstanz – und haften bei Schäden. Ohne passenden Versicherungsschutz können Reparaturen Ihre Rendite ruinieren oder gar zur Zahlungsunfähigkeit führen.
Absicherung von Mietausfällen durch versicherte Schäden
Weitergabe der Kosten an Mieter über die Betriebskostenabrechnung
Schutz bei Vandalismus oder mutwilliger Beschädigung durch Dritte
Voraussetzung für eine reibungslose Finanzierung durch Banken
Was kostet der Schutz pro Quadratmeter – und warum variiert er so stark?
Kosten der Wohngebäudeversicherung pro Quadratmeter – aktuelle Zahlen und Einflussfaktoren
Die Kosten einer Wohngebäudeversicherung pro Quadratmeter hängen von verschiedenen Faktoren ab. Neben der Wohnfläche spielen auch Baujahr, Zustand, Lage des Gebäudes und der gewünschte Versicherungsumfang eine Rolle.
Die Kosten für eine Wohngebäudeversicherung pro Quadratmeter variieren je nach individuellen Gegebenheiten der Immobilie. Für ein Einfamilienhaus liegen die jährlichen Kosten in der Regel zwischen 3 und 6 Euro pro Quadratmeter. Bei Mehrfamilienhäusern können die Kosten etwas höher ausfallen, etwa zwischen 4 und 8 Euro pro Quadratmeter. Zusätzliche Leistungen wie der Schutz vor Elementarschäden können die Kosten auf 10 Euro oder mehr pro Quadratmeter erhöhen.
Die Lage des Gebäudes beeinflusst ebenfalls die Prämie. In Regionen mit höherem Risiko für Naturkatastrophen, wie Hochwassergebieten, sind die Prämien in der Regel höher.
Ein weiterer Faktor ist der Zustand des Gebäudes. Neuere und gut gewartete Gebäude gelten oft als weniger riskant und können daher niedrigere Kosten bei der Gebäudeversicherung bedeuten. Ältere Gebäude oder solche mit bekannten Mängeln können höhere Versicherungskosten verursachen.
Die Wahl des Versicherungsumfangs beeinflusst ebenfalls die Kosten. Ein Basisschutz deckt in der Regel Schäden durch Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel ab. Erweiterungen wie der Schutz vor Elementarschäden oder Vandalismus erhöhen die Prämie entsprechend.
Zusätzlich können individuelle Vereinbarungen wie eine höhere Selbstbeteiligung oder Rabatte für bestimmte Sicherheitsmaßnahmen die Kosten beeinflussen. Ein Vergleich verschiedener Angebote ist daher empfehlenswert, um den optimalen Schutz zu einem fairen Preis zu finden.
Zwei Wege, ein Ziel – wie Versicherer die Prämie kalkulieren
Quadratmeter oder Wert 1914 – wie wird die Gebäudeversicherung berechnet?
Je nach Versicherer und Tarif wird die Wohngebäudeversicherung entweder anhand der Wohnfläche oder des sogenannten „Werts 1914“ kalkuliert.
Die Berechnungsmethode Ihrer Gebäudeversicherung beeinflusst nicht nur den Beitrag, sondern auch die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Versicherungssumme. In Deutschland haben sich zwei Verfahren etabliert: die Wohnflächenberechnung (pro m²) und die klassische Berechnung nach dem „Wert 1914“.
Die Wohnflächenmethode ist vergleichsweise einfach und kundenfreundlich: Die Versicherung berechnet die Prämie auf Basis der gemeldeten Quadratmeter Wohnfläche. Zusätzlich fließen Angaben zum Baujahr, Gebäudeart, Sanierungsstand, Ausstattungsniveau und Lage in die Berechnung ein. Besonders im digitalen Direktvertrieb wird dieses Verfahren gerne verwendet, da es schnell und ohne aufwendige Wertermittlung auskommt. Der Vorteil für Verbraucher: Die Kosten lassen sich vorab grob selbst einschätzen (z. B. 5 € pro m² Wohnfläche pro Jahr) – vorausgesetzt, die Fläche wurde korrekt erfasst.
Demgegenüber steht die Berechnung nach dem sogenannten „Wert 1914“. Dieser fiktive Wert beschreibt, was der Wiederaufbau des Gebäudes im Jahr 1914 gekostet hätte – unabhängig von Inflation oder heutigen Baupreisen. Um daraus den heutigen Versicherungswert zu ermitteln, wird der Wert 1914 mit dem jährlich festgelegten Baupreisindex (2024: Faktor 25,87; 2025: voraussichtlich rund 27,25) multipliziert. Die Methode ist präziser, weil sie stärker auf die tatsächliche Wiederherstellung des Gebäudes nach einem Totalschaden abzielt. Allerdings ist sie für Laien kaum nachvollziehbar und setzt eine fachgerechte Ermittlung voraus – etwa durch den Versicherer oder Makler.
Versicherungen, die nach Wert 1914 kalkulieren, bieten in der Regel einen Unterversicherungsverzicht an – das bedeutet: Im Schadensfall wird nicht geprüft, ob die Versicherungssumme zu niedrig war. Bei der Quadratmetermethode ist dieser Schutz nur dann gegeben, wenn die Angaben vollständig und korrekt gemacht wurden.
Welche Methode besser ist, hängt vom Einzelfall ab. Für Standardobjekte mit durchschnittlicher Ausstattung genügt häufig die Quadratmeterpauschale. Bei besonderen Gebäuden, wie Altbauten, luxuriösen Einfamilienhäusern oder denkmalgeschützten Immobilien, ist die detaillierte Wertermittlung nach dem Wert 1914 oft die bessere Wahl.
Erweiterter Schutz – wenn Standarddeckung allein nicht reicht
Diese Zusatzbausteine sollten Sie bei der Kostenkalkulation nicht vergessen
Die Wohngebäudeversicherung in ihrer Basisform deckt nur eine begrenzte Zahl an Gefahren ab – meist Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel. Doch viele Risiken wie Überschwemmung, unbenannte Schäden oder Photovoltaik-Anlagen sind nicht automatisch enthalten. Gerade bei der Beitragskalkulation pro Quadratmeter sollten Sie diese optionalen Bausteine einbeziehen. Denn sie machen aus einer Basisversicherung einen wirklich umfassenden Schutz – individuell abgestimmt auf Ihr Gebäude

Schützt vor Naturgewalten, die mit dem Klimawandel häufiger auftreten: Starkregen, Überschwemmung, Rückstau, Erdrutsch oder Lawinen. Ohne diesen Baustein ist bei Extremwetter oft keine Leistung versichert – besonders relevant in Hochrisikogebieten und Neubaugebieten ohne Kanalpuffer.

Erforderlich für alle Hauseigentümer mit Solaranlagen – ob privat genutzt oder vermietet. Versichert sind Schäden durch Feuer, Sturm, Überspannung, Diebstahl oder Bedienfehler. Auch Ertragsausfälle nach einem Schaden können je nach Tarif mit abgedeckt werden.

Dieser Zusatzschutz greift bei plötzlich eintretenden Schäden, die nicht explizit im Vertrag aufgeführt sind – z. B. durch Konstruktionsfehler, Materialversagen oder Vandalismus. Besonders sinnvoll bei hochwertigen Immobilien oder individuellen Ausstattungen.
So wirken sich Quadratmeter, Lage und Tarifwahl konkret auf Ihre Prämie aus
Beispielrechnung – was kostet die Gebäudeversicherung pro Quadratmeter?
Eine Beispielrechnung zeigt anschaulich, wie sich individuelle Gegebenheiten auf die tatsächliche Versicherungsprämie auswirken – und warum Vergleichen bares Geld spart.
Wie hoch sind die realistischen Kosten für eine Gebäudeversicherung pro Quadratmeter? Die Antwort hängt von vielen Faktoren ab – aber ein Rechenbeispiel hilft, ein erstes Gefühl für mögliche Prämienhöhen zu entwickeln.
Beispiel 1: Standard-Einfamilienhaus
- Baujahr 2006, 140 m² Wohnfläche
- Region: Bayern, geringe Risiken
- Versicherung: Basisdeckung
Beispiel 2: Neubau mit PV-Anlage
- Baujahr 2022, 180 m² Wohnfläche
- Region: Rheinland-Pfalz, mittleres Risiko
- Versicherung: inkl. PV & Elementar
Beispiel 3: Altbau in Risikozone
- Baujahr 1970, 120 m² Wohnfläche
- Region: NRW, Hochwasserzone
- Versicherung: erweitert + Rückstau
Diese Beispiele zeigen: Je nach Objektzustand, Ausstattung und Lage kann die Prämie stark variieren – bei nahezu identischer Quadratmeterzahl. Insbesondere Elementargefahren und Zusatzbausteine haben einen spürbaren Einfluss auf die Kosten. Wichtig: Einige Versicherer bieten pauschale m²-Tarife mit Unterversicherungsverzicht, andere kalkulieren nach dem gleitenden Neuwert – was ebenfalls Unterschiede verursacht.
Ein gezielter Vergleich mehrerer Anbieter ist daher unerlässlich, um realistische Beiträge zu kalkulieren – ohne auf wichtigen Schutz zu verzichten.
Warum identische Häuser an verschiedenen Orten völlig unterschiedlich kosten können
Region, Baujahr und Zustand – wie stark beeinflussen sie die Kosten der Gebäudeversicherung?
Die Quadratmeterzahl allein reicht nicht aus, um die Versicherungsprämie realistisch einzuschätzen. Erst durch die Berücksichtigung von Lage, Alter und Zustand entsteht ein vollständiges Bild.
Versicherer kalkulieren Risiken heute sehr differenziert – und das hat gute Gründe. Denn ein Haus in einer hochwassergefährdeten Region ist anders zu bewerten als eines auf einem trockenen Höhenzug. Ähnlich verhält es sich mit älteren Immobilien, deren Bausubstanz nicht mehr dem heutigen Standard entspricht. Diese Faktoren haben direkten Einfluss auf die Beitragshöhe Ihrer Wohngebäudeversicherung – und damit auch auf die durchschnittlichen Kosten pro Quadratmeter.
Die Region ist einer der wichtigsten Preisfaktoren. Je nach Postleitzahl werden Immobilien bestimmten Gefährdungsklassen zugeordnet – etwa nach dem Zonierungssystem ZÜRS (für Elementarrisiken wie Überschwemmung, Rückstau oder Erdrutsch). In einer Gefährdungsklasse 4 (hohes Risiko) kann die Prämie um bis zu 500 % höher ausfallen als in Zone 1. Auch Sturmrisiken, Einbruchhäufigkeit oder Bodenverhältnisse spielen in manchen Tarifen eine Rolle.
Das Baujahr ist ein Indikator für technische Standards, Bauweise und Modernisierungsbedarf. Ältere Häuser gelten – sofern nicht umfassend saniert – als anfälliger für Schäden, etwa durch veraltete Leitungen, mangelhafte Dämmung oder unzureichenden Brandschutz. Viele Versicherer staffeln die Beiträge in Baujahrklassen und gewähren Prämienvorteile bei nachgewiesenen Sanierungen.
Der Gebäudezustand ist ebenfalls entscheidend. Ein gepflegtes, regelmäßig instand gehaltenes Haus gilt als risikoärmer. Besonders relevant sind Dach, Heizung, Elektro- und Wasserleitungen. Wer hier investiert, kann nicht nur Schäden vermeiden – sondern oft auch niedrigere Beiträge erzielen. Manche Versicherer verlangen bei Altbauten konkrete Angaben zu letzten Sanierungen, z. B. “Dach erneuert 2015”, um einen Tarif mit Unterversicherungsverzicht zu gewähren.
Kurzum: Zwei Häuser mit gleicher Fläche und Ausstattung, aber unterschiedlicher Lage oder Baualtersklasse, können völlig unterschiedliche Beiträge verursachen. Deshalb sollte eine fundierte Risikoeinschätzung immer vor Abschluss – und regelmäßig im Verlauf – erfolgen.
Transparente Antworten auf die wichtigsten Preisfragen – praxisnah und fundiert
Was Sie schon immer über die Kosten pro Quadratmeter bei der Wohngebäudeversicherung wissen wollten
Wie setzen sich die Beiträge zusammen? Welche Unterschiede gibt es je nach Region oder Baujahr? Und wie lässt sich die Versicherungssumme korrekt kalkulieren? Wir geben klare Antworten.
Wie viel kostet eine Wohngebäudeversicherung pro Quadratmeter im Durchschnitt?
Die Kosten liegen aktuell (2025) je nach Lage, Zustand und Tarifwahl zwischen 2 und 10 Euro jährlich pro m². In ländlichen Regionen mit geringem Risikopotenzial ist eine solide Police ab 3 €/m² realistisch, während in Hochwasserzonen oder mit erweitertem Schutz bis zu 10 €/m² möglich sind.
Wird immer pro Quadratmeter gerechnet?
Nein. Viele Direktversicherer arbeiten mit Quadratmeterwerten, während klassische Anbieter oft den Wert 1914 in Verbindung mit dem gleitenden Neuwertfaktor nutzen. Beide Methoden haben ihre Berechtigung – wichtig ist, dass die Versicherungssumme korrekt ermittelt und ein Unterversicherungsverzicht eingeschlossen ist.
Was passiert, wenn ich die Wohnfläche falsch angebe?
Eine zu niedrig angegebene Fläche kann im Schadenfall zur Leistungskürzung führen. Nur bei Tarifen mit Unterversicherungsverzicht entfällt die Prüfung – Voraussetzung: Die Angaben zur Wohnfläche, Ausstattung und Sanierung sind vollständig und korrekt.
Warum ist die Region so wichtig für die Beitragshöhe?
Versicherer bewerten das Schadensrisiko nach ZÜRS-Zonen (z. B. für Hochwasser) und weiteren Risikofaktoren wie Sturmhäufigkeit, Einbruchstatistiken oder geologischen Besonderheiten. Ein Haus in Zone 4 (hohes Hochwasserrisiko) kann bis zu 5x teurer versichert werden als ein gleiches Haus in Zone 1.
Wie stark wirkt sich das Baujahr auf den Beitrag aus?
Häuser, die vor 1980 gebaut und nicht saniert wurden, gelten als risikobehaftet – wegen veralteter Leitungen, mangelhafter Dämmung oder Brandschutz. Sanierte oder neuere Gebäude erhalten deshalb deutlich günstigere Beiträge – teils mit bis zu 30 % Rabatt.
Was kostet eine Police für ein typisches Einfamilienhaus?
Ein Haus mit 140 m² Wohnfläche, Standardausstattung, in mittlerer Risikoregion, liegt bei ca. 350–550 € pro Jahr. Mit Elementarbaustein oder Photovoltaik kann der Beitrag auf 700–900 € steigen, je nach Anbieter und Tarifmodell.
Kann ich die Kosten auf meine Mieter umlegen?
Ja – gemäß Betriebskostenverordnung dürfen Vermieter die Gebäudeversicherung auf die Mieter umlegen, anteilig nach Wohnfläche. Die Police muss jedoch angemessen und marktüblich sein – sonst kann der Mieter Widerspruch einlegen. ([§2 Nr.13 BetrKV])
Wann sollte ich meinen Vertrag überprüfen oder wechseln?
Spätestens bei Sanierungen, Anbauten, veränderten Risikolagen oder nach Preiserhöhungen ist ein Vergleich ratsam. Viele Altverträge sind überteuert oder bieten unzureichenden Schutz. Ein Wechsel spart oft mehrere Hundert Euro jährlich – bei besserer Leistung.
Weitere Themen, die für Eigentümer wichtig sind
Das könnte Sie auch interessieren

Ob vermietetes Haus oder selbstgenutzte Immobilie – die richtige Kalkulation ist entscheidend. Erfahren Sie, welche Faktoren den Beitrag beeinflussen und wie Sie Einsparpotenzial erkennen, ohne beim Schutz Kompromisse einzugehen.

Nicht jede Police schützt gleich gut: Manche Anbieter leisten nur bei grober Fahrlässigkeit, andere schließen Risiken aus. Mit einem gezielten Vergleich finden Sie den Tarif, der exakt zu Ihrer Immobilie passt – fair, leistungsstark und transparent.
Zusammenfassung
Die Kosten für eine Wohngebäudeversicherung pro Quadratmeter lassen sich nicht pauschal beziffern – sie hängen von vielen Faktoren ab: Wohnfläche, Lage, Baujahr, Sanierungszustand und natürlich dem gewählten Deckungsumfang. Während ein Basis-Tarif in risikoarmer Lage bereits ab 2–3 €/m² jährlich erhältlich ist, können in Hochrisikogebieten mit erweitertem Schutz schnell 8–10 €/m² fällig werden. Auch Zusatzbausteine wie Elementar- oder Photovoltaikversicherung schlagen sich spürbar in der Prämie nieder. Ein Vergleich lohnt sich daher immer – insbesondere bei Altverträgen. Wichtig bleibt: Nur wer seine Immobilie realistisch einstuft und seinen Versicherungsschutz regelmäßig überprüft, vermeidet Über- oder Unterversicherung und zahlt wirklich nur das, was nötig ist.
Häufige Fragen
Wird die Gebäudeversicherung nach Quadratmeter berechnet?
Ja, einige Versicherer berechnen die Prämie anhand der Wohnfläche in Quadratmetern – kombiniert mit Angaben zu Baujahr, Zustand und Ausstattung. Alternativ nutzen klassische Anbieter den Wert 1914 und multiplizieren ihn mit dem aktuellen Baupreisindex.
Wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten für eine Gebäudeversicherung pro Quadratmeter?
Die durchschnittlichen Kosten liegen 2025 je nach Region, Tarif und Ausstattung zwischen 2 und 10 Euro jährlich pro Quadratmeter. In risikoarmen Gebieten mit Basisschutz kann es auch günstiger sein – in Hochrisikozonen oder mit Zusatzbausteinen entsprechend teurer.
Wie viel kostet eine Gebäudeversicherung pro Jahr?
Für ein Einfamilienhaus mit etwa 140 m² Wohnfläche zahlen Eigentümer im Schnitt zwischen 300 und 700 Euro jährlich – je nach Lage, Anbieter und gewähltem Schutzumfang. Eine Elementarversicherung oder erweiterte Deckung erhöhen diesen Wert.
Was kostet im Durchschnitt eine Gebäudeversicherung?
Im bundesweiten Durchschnitt liegen die Beiträge laut GDV je nach Gebäudegröße, Alter und Risikobewertung bei etwa 450–600 Euro pro Jahr. Die tatsächlichen Kosten variieren jedoch stark und sollten stets individuell kalkuliert werden – am besten mit einem Tarifvergleich.

